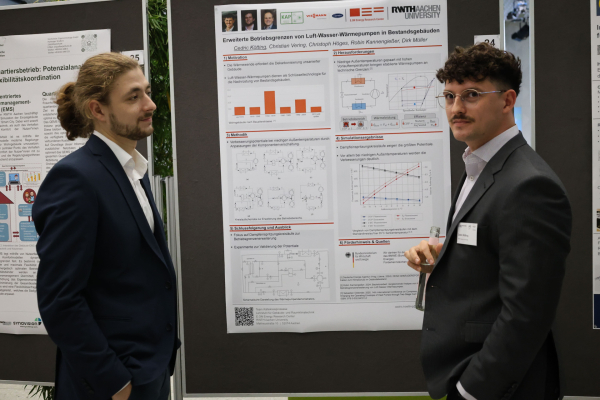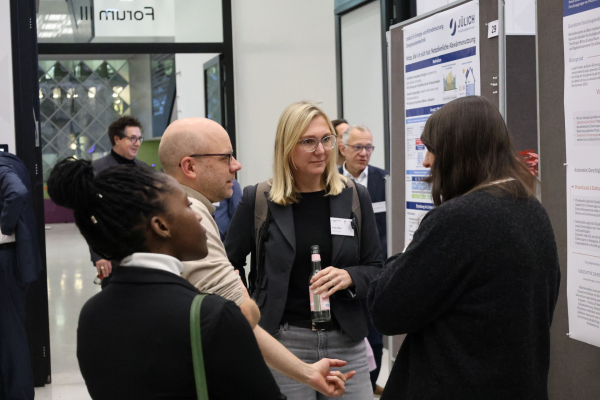2. Energieforschungskonferenz des BMWE: „Wir brauchen mutige Forschende“
Mit neuen Förderaufrufen und einer Transferoffensive für Energieinnovationen will das BMWE den deutschen Standort stärken. Bei der 2. Energieforschungskonferenz erklärten Fachleute aus Forschung und Wirtschaft, wie man Energie klimafreundlicher und günstiger bereitstellen könnte – und zwar weltweit.
Ablehnung aus den USA, Konkurrenz aus China und trotzdem - oder gerade deshalb - große Chancen für die deutsche Energieforschungslandschaft: Die Eröffnungsreden der 2. Energieforschungskonferenz des BMWE zeigten, wie vielfältig die Herausforderungen sind, denen sich die angewandte Energieforschung stellen muss.
Den Auftakt in Berlin machte am Dienstag, 11. November, Stephanie von Ahlefeldt, Abteilungsleiterin für Energieeffizienz, Wärme und Energieforschung im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE). Es gebe in der Energieforschung eine Vielfalt an Gewinnerthemen, konstatierte sie vor den rund 300 Teilnehmenden vor Ort und zahlreichen weiteren Zuschauerinnen und Zuschauern im Stream, viele davon selbst Mitglieder in den Forschungsnetzwerken Energie. Diese Themen wolle das BMWE weiter stärken, 2026 voraussichtlich mit noch umfangreicheren Fördermitteln als in diesem Jahr.
Zudem kündigte von Ahlefeldt eine neue „Transferoffensive Energieinnovationen“ an, die einen schnelleren Übergang von Forschungsergebnissen in die Praxis ermöglichen soll. Dazu sollen Innovationswettbewerbe, Demonstrationsprojekte und der Aufbau von Testinfrastrukturen gefördert werden. Zwei weitere Schwerpunkte bilden der Neustart der Reallabore, bei denen Projekte auch Praxistests im industriellen Maßstab standhalten sollen, und die Explorationsinitiative Geothermie. Für weitere Schlüsselbereiche seien ebenfalls Förderaufrufe geplant, wie Cyberresilienz, klimaneutrale Prozesswärme durch Industriewärmepumpen und -wärmespeicher, kosteneffiziente Sanierung von Bestandsgebäuden, Transformation von Quartieren, Kostensenkung bei Fernwärmeleitungen.
Wunsch nach weniger Bürokratie
„Energie ist ein Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Forschung“, betonte von Ahlefeldt: „Dafür brauchen wir mutige Forschende, aber auch mutige Unternehmen, die in Forschung und Entwicklung investieren. Mit einer langfristigen Perspektive.“ Dafür sei insbesondere der Mittelstand prädestiniert. Für diesen sollen auch bürokratische Hürden verringert werden.
Damit stieß sie bei Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), auf Zustimmung: Man brauche weniger Bürokratie. Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Energie seien für Bevölkerung und Industrie zwei Schlüsselfaktoren. Wichtig sei zudem ein gesellschaftlicher und politischer Konsens, forderte Andreae. Das bedeute: Planungssicherheit für Investitionen sowie Menschen für die Transformation zu begeistern. Deutschland habe eine große Innovationskraft - und gerade Innovationsforen wie die Forschungsnetzwerke Energie seien wichtig.
Chance für einen innovationsstarken Standort
Die Ursache allen Handlungsdrucks seien die großen Krisen unserer Zeit, etwa die Klimakrise, erklärte Dr. Martin Keller, seit Anfang November neuer Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft. Dabei gehe es aus seiner Sicht auch in die richtige Richtung: Innovationen flössen weltweit zunehmend in Erneuerbare, Clean Tech boome. „Und wenn die USA sich da zurückziehen, dann ist das unsere Chance in Deutschland“, sagte Keller, der zuvor unter anderem in den USA tätig war. Er unterstrich die europäische und insbesondere die deutsche Innovationsstärke in langfristigen Zukunftstechnologien wie der Fusionstechnik, betonte aber auch, dass in Bereichen wie Solar, Wind und Speichern noch große Innovationssprünge möglich seien.
„Dinge, die wir als Industrie und in der Forschung anpacken, können nicht auf Deutschland begrenzt sein, sondern müssen auch immer den Blick in die Welt richten“, betonte schließlich Dr. Britta Buchholz, Vice President des Technologiekonzerns Hitachi Energy und Vorsitzende des Beirats zum Energieforschungsprogramm des BMWE. Wenn Deutschland es zum Beispiel schaffe, die Herausforderungen eines wachsenden, variablen Anteils erneuerbarer Energiequellen im Stromnetz zu meistern, könne sich das die Welt abschauen. „Was aus der Industriesicht wichtig ist, ist dass die angewandte Forschung aus Deutschland von Anfang an international gedacht wird. Denn nur dann kann sie sich dort wiederfinden.“
Energieforschung als wichtiger Kompass
Dr. Rodoula Tryfonidou, Leiterin des Referats IIC1 Energieforschung – Grundsatzfragen und Strategie im BMWE eröffnete Tag 2 der Energieforschungskonferenz. Dabei betonte sie, dass der Weg in das Energiesystem der Zukunft nur gemeinsam mit der Forschung gelingen könne. Die Energieforschung in Forschungszentren, Universitäten, aber auch in Unternehmen sei ein Kompass in einem Umfeld, das sich laufend verändere. Sie begleite Schritte der Energiewende, zeige neue Wege auf und gewährleiste die wissenschaftliche Sicherung dieser.
„Energieforschung vernetzt Technik, Wirtschaft und Gesellschaft“, sagte Tryfonidou. Gefragt seien nicht schnelle Antworten, sondern tragfähige Lösungen. Wichtig dafür: Forschungsergebnisse müssten auch in eine breite Umsetzung kommen und einen neuen Stand der Technik setzen. Mit Blick auf die Zukunft sagte sie den Teilnehmenden: „Das Thema Forschungstransfer wird ein, wenn nicht gar das wichtigste Thema in der künftigen Energieforschungspolitik des BMWE werden. Und Sie als Forscherinnen und Forscher leisten dafür unverzichtbare Beiträge.“
Im Anschluss hatten die Teilnehmenden Gelegenheit, sich an 18 verschiedenen Thementischen über aktuelle Themen und Herausforderungen auszutauschen und Synergien zu finden - darunter Fragen rund um den Transfer von Energieforschung in die Praxis, den Beitrag von Forschung zur Resilienz des Energiesystems, den Einfluss und Nutzen von KI, die Transformation zu einer zirkulären Wirtschaft und mehr Flexibilität, Effizienz und Sektorenkopplung im Energiesystem.