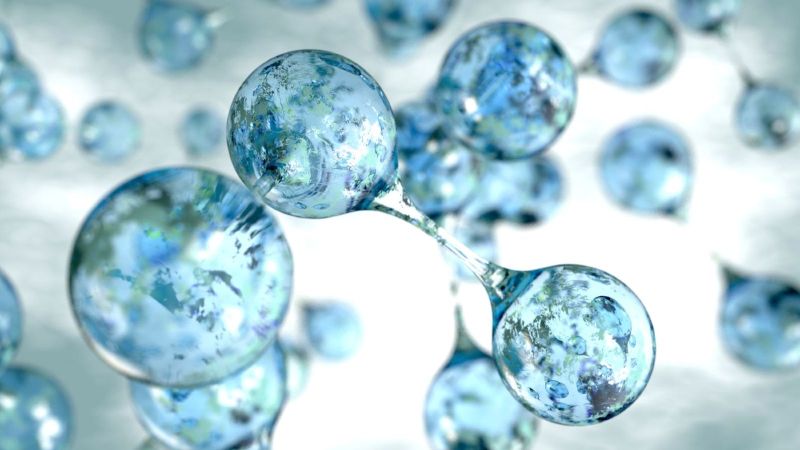
Zwei Jahre Diskussions-Reihe: Wasserstoffforschung online
Seit Sommer 2023 organisiert das Forschungsnetzwerk Wasserstoff die Online-Veranstaltungsreihe „Wasserstand: Aktuelles aus der H2-Forschung“. Regelmäßig geben dabei Wasserstoff-Expertinnen und -Experten aus Industrie, Hochschulen und Forschungseinrichtungen Einblick in ihre aktuellen Projekte.
Das Wasserstand-Format ist simpel: Freitagvormittags haben Forschende aus bis zu drei Projekten insgesamt 90 Minuten Zeit, ihre Themen vorzustellen und mit den Teilnehmenden online darüber zu diskutieren. Dabei können die vorgestellten Inhalte so unterschiedlich sein, wie die Hintergründe der mehr als 1.300 aktiven Mitglieder im Forschungsnetzwerk Wasserstoff. Zu sehen war dies beispielsweise beim Wasserstand-Termin am 15. August 2025.
Projekt BBH2: Blockchain-basierter Wasserstoffmarkt
Ziel des Forschungsprojekts BBH2 war es, die Eignung von Blockchain-Technologie und Smart Contracts für einen zukünftigen europäischen Wasserstoffmarkt zu erproben. Der Fokus lag darauf, dezentrale digitale Herkunftsnachweise für grünen Wasserstoff zu entwickeln und digitale Marktprozesse für Wasserstoff abzubilden – vom Erzeuger von erneuerbaren Energien über Wasserstoffproduzenten und Netzbetreibern bis zum Endverbraucher. Vorgestellt wurde das Projekt, das im Juli 2025 geendet ist, von Dr. Volker Wannack von der Hochschule Mittweida und Steffen Herndl vom Technologie- und Beratungsunternehmen Exxeta.
Die Fachleute haben ein Minimum Viable Product entwickelt, also ein erstes, funktionsfähiges System, das die wichtigsten Kernfunktionen enthält, um mittels Nutzerfeedback die grundsätzliche Eignung zu prüfen und danach iterativ zu erweitern. Konkret haben die Fachleute eine geeignete Blockchain als Basistechnologie mit einer gemeinsamen Datenbank und Plattform entwickelt. Auf diese können alle in der Prozesskette beteiligten Akteure entsprechend ihrer Rolle ihre notwendigen Handels- und Transaktionsprozesse abwickeln, wie Abrechnungs-, Melde- und Nachweisprozesse.
Die fachlichen Anforderungen für die Datenhaltung und Funktionen der Blockchain wurde zur Dokumentation der Lieferkette sowie entsprechend der europäischen RED (Erneuerbare-Energien-Richtlinie) II / III Regulierung gewählt. Den hierauf basierten Demonstrator haben die zwei Experten während des Wasserstand-Termins vorgeführt sowie die noch offenen Herausforderungen dargestellt. Das Forschungsprojekt BBH2 wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit rund 670.000 Euro gefördert.
Projekt E2ngel: Hochstromfähige Elektroden für die alkalische Elektrolyse
Die Forschenden im Forschungsprojekt E2ngel haben sich zum Ziel gesetzt, hohe Stromdichten bei der alkalischen Elektrolyse zu erreichen, ohne dabei Edelmetalle zu verwenden. Dr. Karsten Lange von Rheinmetall hat in seinem Vortrag einen Einblick gegeben, wie das Konsortium aus zwei Unternehmen und einer Forschungseinrichtung bei der Elektrodenentwicklung vorgegangen ist.
Um Wasserstoff herzustellen, existieren unterschiedliche Elektrolyseverfahren. Bei der Elektrolyse wird eine Spannung an die Elektroden angelegt, die oberhalb der Zersetzungsspannung des Wassers liegt. Der dadurch entstehende Stromfluss führt zur Bildung von Wasserstoff an der Kathode und Sauerstoff an der Anode. Bei einem höheren Stromfluss erhöht sich auch die Ausbeute an Wasserstoff pro cm² Elektrodenoberfläche. Darüber hinaus erlaubt eine hohe Stromdichte einen dynamischen Betrieb der Anlage. Jedoch werden für eine hohe Stromdichte üblicherweise teurere Elektroden benötigt. In einigen hochstromfähigen alkalischen Elektrolyseurkonzepten werden Edelmetalle eingesetzt.
Die Fachleute haben sich mit unterschiedlichen Elektrodensubstraten und Katalysatorsystemen beschäftigt: Von den 200 hergestellten Elektroden haben sie 100 getestet. Zunächst in einem 1.000 Stunden Versuch im Labormaßstab. Dann haben die Fachleute die Elektroden skaliert und eine Testanlage mit einem 25-Zellen-Stack aufgebaut. Dort läuft noch bis Dezember ein 4.000 Stunden Test. Die bisherigen Ergebnisse hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Stabilität scheinen überzeugend: Der Projektpartner Rheinmetall plant die Herstellung der in E2ngel entwickelten Elektroden in seiner Pilotfertigung. Zudem plant das Konsortium ein Folgeprojekt, um die Elektroden bei noch höheren Stromdichten zu testen. Das Projekt E2ngel wird vom BMWE mit rund 2,5 Millionen Euro gefördert.
Projekt EnerOptA: Mehr Effizienz für Power-to-Gas-Reaktoren durch Wärmespeicher
Wasserstoff nutzen, um daraus synthetisches Erdgas herzustellen und das möglichst effizient – darum geht es im Forschungsprojekt EnerOptA. Die Fachleute untersuchen, wie sich Power-to-Gas-Synthesereaktoren durch integrierte Wärmespeicher energie- und kosteneffizienter betreiben lassen. Die Forscher Dr. Benjamin Jäger vom Fraunhofer IKTS und Dr. Stefan Schmidt von der Ernst-Abbe-Hochschule Jena haben im Vortrag erklärt, wie überschüssiger Strom aus erneuerbaren Energien in synthetisches Erdgas umgewandelt, gespeichert und später wieder zur Stromerzeugung genutzt werden kann.
Ein Schwerpunkt des Projekts ist das energieaufwändige Wiederanfahren der Methanisierungsreaktoren: Für den Start sind über 300 Grad Celsius nötig. Statt externer Beheizung nutzen die Forschenden die während der Reaktion (Kohlenstoffdioxid reagiert zusammen mit Wasserstoff zu Methan und Wasser) entstehende Abwärme, die gespeichert und gezielt zum erneuten Anfahren eingesetzt wird. Getestet wurde das Konzept in Simulationen und Laborversuchen. Aktuell entsteht in Zwickau eine Feldanlage an einer Biogasanlage, die bis zu 8,5 Kubikmeter synthetisches Erdgas pro Stunde herstellen soll. Dort wird geprüft, wie sich das Wärmespeicherkonzept im realen Betrieb auf die Wirtschaftlichkeit auswirkt. Das Forschungsprojekt EnerOptA wird vom BMWE mit rund 1,4 Millionen Euro gefördert.

